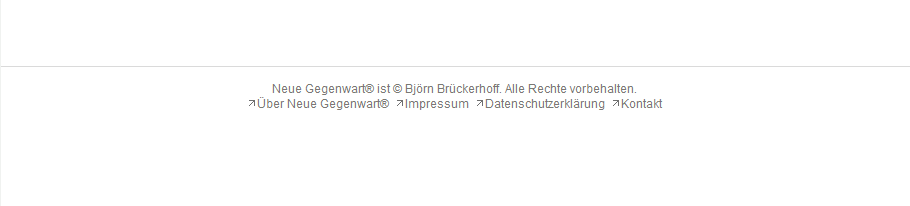|
Seit 15 Jahren
gibt es das World Wide Web, doch erst in den vergangenen zehn Jahren hat
es sich zu einem Massenmedium entwickelt, das aus dem Alltag der
meisten Menschen in den Industrieländern nicht mehr wegzudenken ist. Die
Vielfalt der technischen Entwicklungen seit Ende der 90er-Jahre, aber auch
die Moden, Klassiker und Sünden des Web-Designs kann jeder Online-Nutzer mit
Hilfe des
 Internet Archive selbst nachvollziehen. Dort sind
beispielsweise die erste Startseite von Google aus dem Jahr 1998 („ Internet Archive selbst nachvollziehen. Dort sind
beispielsweise die erste Startseite von Google aus dem Jahr 1998 („ Might-work-some-of-the-time-prototype“), die ersten Gehversuche der deutschsprachigen Wikipedia von 2002 („ Might-work-some-of-the-time-prototype“), die ersten Gehversuche der deutschsprachigen Wikipedia von 2002 („ Wir haben
bereits 5183 Artikel“) und die Anfänge von Wir haben
bereits 5183 Artikel“) und die Anfänge von
 YouTube aus dem Jahre 2005 zu
besichtigen. YouTube aus dem Jahre 2005 zu
besichtigen.
In die Zeit von 1998 bis 2008 fallen aber nicht nur
Veränderungen des Gesichts des Webs durch technische Neuerungen. Mancher
Online-Nutzer erinnert sich sicherlich noch an die privaten Homepages aus
frühen Homepagebaukästen, die voller blinkender Gif-Grafiken und greller
Laufschriften waren; eventuell empfindet er die moderneren
Voll-Flash-Installationen einiger heutiger Web-Auftritte als nicht weniger
hyperaktiv.
Mit dem Aufstieg
und Fall der Dot.com-Manie 2000 und 2001 und dem weit vorsichtigeren Boom
jener Online-Dienste, die gemeinhin mit dem Schlagwort Web 2.0 bezeichnet
werden, waren die letzten zehn Jahre auch wirtschaftlich für das Internet
und seine Macher eine bewegte Zeit. Und in der Folge der geplatzten
Dot.com-Blase musste auch die Gesellschaft im Real Life erfahren,
welches Gewicht das Internet inzwischen gewonnen hatte.
Gesellschaftliche
Fragen der „Datenautobahn“ beschäftigten von Anfang an Politiker,
Philosophen und Wissenschaftler. Wie so oft, wenn ein neues Medium immer
populärer wird, ruft es neben manchmal überzogener Euphorie auch Ängste und
Befürchtungen hervor – die freilich ebenfalls oft nicht realistisch sind.
Zehn Jahre vielfältiger Entwicklung des World Wide Web sind ein geeigneter
Anlass, ein Zwischenfazit zu ziehen. Welche Utopien sind gescheitert, welche
Lebenslügen enttarnt worden? Welche Hoffnungen haben sich erfüllt, welche
unerwarteten Geschenke hat das Netz seinen Nutzern gemacht?
Die Kommunikationswissenschaftlerin Margot Berghaus formulierte im Jahr 1997
„Sieben Thesen und ein Fazit“ zu der Frage „Was macht Multimedia mit
Menschen, was machen Menschen mit Multimedia?" (Berghaus 1997).
Dabei umfasst der Multimediabegriff zwar mehr als das World Wide Web, rückblickend
betrachtet sind die Thesen jedoch vor allem darauf anwendbar: „CD-ROM und CDi“ erreichten nie die Verbreitung, die das WWW heute hat, „interaktives
Fernsehen mit Settop-Box“ ist immer noch kein Massenmedium geworden und
„Computersimulationen, Virtual Reality usw.“ sind heute vielfach integraler
Bestandteil des World Wide Web und nicht auf externe Anwendungen wie
Spielkonsolen beschränkt.
Medienkonkurrenz
Aus der ersten
Berghaus-These stammt der Satz „Nach dem Fernseh-Zeitalter kommt das
Multimedia-Zeitalter“ (Berghaus 1997: 74)
– eine Annahme, die Medienforscher direkt zur Frage der substituierenden
Mediennutzung führt: Sehen Menschen weniger fern, weil sie das Internet
nutzen? Die Frage ist nur differenziert zu beantworten. Bestimmte, vor allem
jüngere Online-Nutzer-Typen wie „Junge Wilde“ und „Zielstrebige Trendsetter“
gaben in der ARD/ZDF-Online-Studie an, dass sie ihren Fernsehkonsum
reduziert hätten (sehen aber auch Printmedien und das Radio von dieser
Substitution betroffen). Die Wahrnehmung der Internetnutzer wird dabei durch
Daten zur tatsächlichen Nutzungsdauer gestützt: Wer ein beschränktes
Zeitbudget für die Mediennutzung hat, muss seine Online-Zeit von anderen
Medien abziehen (Oehmichen/Schröter 2007: 416f.).
Davon ist in vielen Fällen besonders das Fernsehen betroffen, stellte es
doch früher einen besonders großen Teil der für die Mediennutzung
aufgewandten Zeit. Gleichwohl verfällt das Fernsehen nicht in
Bedeutungslosigkeit, ist bislang nicht vom Internet völlig verdrängt worden.
Global betrachtet sehen Onlinenutzer sogar etwas mehr fern als Nichtnutzer
(van Eimeren/Frees 2007: 376).
Der von Margot Berghaus erwartete Zeitenwechsel deutet sich also zwar
weiterhin an, ist aber noch lange nicht vollzogen.
Die Frage, ob das
überhaupt jemals geschehen wird, führt zur zweiten These aus dem Jahr 1997:
„Multimedia verdrängt nicht das Fernsehen und die anderen ‚alten‘ Medien.
Die ‚alten‘ werden zu einer Steuerungs-, Orientierungs- und
Zulieferungsinstanz für die ‚neuen‘ Medien“ (Berghaus 1997: 75).
Dieser als Riepl’sches Gesetz bekannt gewordenen Annahme zum Trotz
wurden in der Vergangenheit immer wieder Kommunikationsmittel zur Ablösung
durch elektronische Kommunikation vorgeschlagen. Erinnert sei in diesem
Zusammenhang an Pläne für das „papierlose Büro“ oder die Überlegung, E-Books
mit geeigneten mobilen Lesegeräten könnten das klassische Buch verdrängen.
Der Tatsache zum Trotz, dass elektronische Bücher heutzutage in den
verschiedensten Formaten durchaus
 eine Rolle für eine Rolle für
 den Interessierten spielen, beweist ein Blick in
eine beliebige Bahnhofsbuchhandlung, dass das klassische Buch keineswegs
ausgedient hat. Und ein Blick in beliebiges Büro zeigt, dass Papierlosigkeit auch im Jahre 2008 noch immer Utopie ist. den Interessierten spielen, beweist ein Blick in
eine beliebige Bahnhofsbuchhandlung, dass das klassische Buch keineswegs
ausgedient hat. Und ein Blick in beliebiges Büro zeigt, dass Papierlosigkeit auch im Jahre 2008 noch immer Utopie ist.
Mitmach-Web?
Die zunehmende
Verfügbarkeit von Online-Kommunikation verändert jedoch nicht nur die
Medienlandschaft, sondern auch ihre Nutzer. Angesichts der Entwicklungen in
dem Bereich, der mit dem Schlagwort Web 2.0 assoziiert wird, scheint
Berghaus‘ These aus dem Jahr 1997 durchaus zutreffend zu sein: „Das
traditionelle Massenmedienmodell gilt nicht mehr: „‘Sender‘, ‚Medium‘ und
‚Empfänger‘ (‚Publikum‘) werden demontiert“ (Berghaus 1997: 77).
„Mitmach-Web“ und Web 2.0 sind in aller Munde, der Rezipient scheint
endgültig den Schritt zum Kommunikator getan zu haben: Blogs, Wikipedia,
Medienplattformen wie Youtube und Produktbewertungsseiten leben vom
Engagement der Nutzer, User-Generated-Content ist zentrales Merkmal des
Phänomens hinter dem Schlagwort Web 2.0 (Kilian/Hass/Walsh 2008).
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass nicht nur das Schlagwort
 einen Entwicklungssprung vorgaukelt, der sich in Wirklichkeit lediglich als
eine kontinuierliche Entwicklung darstellt. Auch die Bedeutung der von
Nutzern bereitgestellten Inhalte wirkt wie durch die Lupe der
YouTube-Euphorie vergrößert. Nur ein geringer Teil der Nutzer der Web
2.0-Plattformen trägt selbst etwas bei: sieben Prozent bei Videoportalen, 25
Prozent bei Weblogs, sechs Prozent bei Wikipedia (laut ARD/ZDF-Onlinestudie,
Gscheidle/Fisch 2007: 401),
der Löwenanteil der Nutzer besteht weiterhin aus klassischen Nur-Rezipienten,
„Lurkern“ im Jargon des Internet. einen Entwicklungssprung vorgaukelt, der sich in Wirklichkeit lediglich als
eine kontinuierliche Entwicklung darstellt. Auch die Bedeutung der von
Nutzern bereitgestellten Inhalte wirkt wie durch die Lupe der
YouTube-Euphorie vergrößert. Nur ein geringer Teil der Nutzer der Web
2.0-Plattformen trägt selbst etwas bei: sieben Prozent bei Videoportalen, 25
Prozent bei Weblogs, sechs Prozent bei Wikipedia (laut ARD/ZDF-Onlinestudie,
Gscheidle/Fisch 2007: 401),
der Löwenanteil der Nutzer besteht weiterhin aus klassischen Nur-Rezipienten,
„Lurkern“ im Jargon des Internet.
 Es ist nicht einmal sicher, dass der
Anteil der aktiven Nutzer heute höher ist als vor zehn Jahren:
Homepage-Baukästen, Web-Chats und das Usenet erlaubten damals schon jedem
Internetnutzer selbst etwas zum Netzinhalt beizutragen; durch die ebenfalls
mit dem Begriff Web 2.0 bezeichneten technischen Weiterentwicklungen wie AJAX
(Asynchronous Javascript and XML, baut
beispielsweise baut auf dem schon lange etablierten Java-Script auf) ist es
lediglich für die breite Masse der heute aktiven Anwender leichter geworden,
sich im Internet zu verewigen. Es ist nicht einmal sicher, dass der
Anteil der aktiven Nutzer heute höher ist als vor zehn Jahren:
Homepage-Baukästen, Web-Chats und das Usenet erlaubten damals schon jedem
Internetnutzer selbst etwas zum Netzinhalt beizutragen; durch die ebenfalls
mit dem Begriff Web 2.0 bezeichneten technischen Weiterentwicklungen wie AJAX
(Asynchronous Javascript and XML, baut
beispielsweise baut auf dem schon lange etablierten Java-Script auf) ist es
lediglich für die breite Masse der heute aktiven Anwender leichter geworden,
sich im Internet zu verewigen.
Grenzen
Die erste
Generation der deutschen Internetnutzer war noch eine technisch versierte,
junge, männliche, gut gebildete Informationselite (van
Eimeren/Frees 2007).
Angesichts dessen formulierte Margot Berghaus im Jahr 1997 ihre
Befürchtungen – aber auch ihre Hoffnungen – hinsichtlich der Wirkung des
Internet auf gesellschaftliche Grenzen: „Eine Grenze zwischen Jung und alt
wird errichtet“, „Eine Grenze zwischen Männern und Frauen wird errichtet“;
aber auch „Die Grenze zwischen sozialem Oben und Unten wird abgeflacht“ (Berghaus 1997: 80f.).
Und in Teilen der Politikwissenschaft wurden Ende der 90er-Jahre Visionen
umfassender politischer Partizipation propagiert, E-Democracy,
Habermas'scher Elitediskurs für alle.
Einiges davon hat
sich bewahrheitet, manches ist inzwischen überwunden und anderes hat sich
als Utopie entpuppt. Der einige Jahre vorherrschende Unterschied bei der
Online-Nutzung durch Männer und Frauen ist deutlich kleiner geworden: 1998
war der Anteil der männlichen Online-Nutzer fast dreimal größer als der der
weiblichen Nutzer (15,7 zu 5,6 Prozent), 2007 liegen die Männer zwar immer
noch vorn, führen aber nur noch mit einem Anteil von 68,9 Prozent gegenüber
den Frauen (56,9 Prozent) (Van Eimeren/Frees 2007: 364).
Eine deutliche Mehrheit von Männern und Frauen ist online. Auch
ältere Menschen finden zunehmend Zugang zum Netz (Van Eimeren/Frees 2007: 363f.)
– wobei man freilich bedenken muss, dass auch Internetnutzer altern und sich
das WWW mit dem Älterwerden ehemals junger Nutzergenerationen automatisch zu
einem „Alte-Leute-Medium“ entwickeln wird. Vormals bestehende soziale
Grenzen – verursacht vor allem durch hohe Kosten für die Online-Nutzung –
sind durch Breitband-Flatrates entschärft worden. Dabei bleibt jedoch die
Tatsache, dass geringe Bildung immer noch hoch mit Nichtnutzung des Internet
korreliert (Gerhards/Mende 2007: 380)
als Problem bestehen. Nicht erfüllt haben sich dagegen die Träume von
totaler E-Partizipation mündiger Web-Nutzer: Das Internet dient den meisten
zwar überwiegend zur Information (van Eimeren/Frees 2007: 368.),
ist aber schon rein inhaltlich kein rein politisches Medium.
Fazit
In zehn Jahren hat
sich im World Wide Web vieles geändert, manches rasant, anderes nur
allmählich. Das Web hat die Medienlandschaft gewandelt aber nicht
revolutioniert, es hat aus Rezipienten Kommunikatoren gemacht, wenn auch
nicht in dem Ausmaß, das der Hype um Web 2.0 nahe legt. Das WWW erreicht
heute mehr Menschen und seine Nutzer zeigen immer weniger soziale
Unterschiede, wenngleich die Be- und Entgrenzungstendenzen auch in diesem
Bereich nicht so hart ausgefallen sind, wie Ende der 90er-Jahre von manchem
erwartet. Die Entwicklung geht weiter und vielleicht hat die Gesellschaft ja
vom semantischen Web („3.0“) oder von
 IPv6, das die Einbindung aller
erdenklichen Alltagsgegenstände ins Internet ermöglicht, die revolutionäre
Entwicklung zu erwarten, die eigentlich schon für Web 1.0 und Web 2.0
vorhergesehen worden war. IPv6, das die Einbindung aller
erdenklichen Alltagsgegenstände ins Internet ermöglicht, die revolutionäre
Entwicklung zu erwarten, die eigentlich schon für Web 1.0 und Web 2.0
vorhergesehen worden war. |
Der Autor

Dr. Thomas Roessing, Jahrgang 1973, studierte in Mainz
Publizistikwissenschaft, Politikwissenschaft und Strafrecht. 2000 bis 2001 war
er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt VIROR (Virtuelle Hochschule
Oberrhein) an der Universität Mannheim. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter und EDV-Beauftragter am
 Institut für Publizistik der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz. 2007 wurde er mit einer Arbeit über
empirische Methoden und Analysestrategien für die Forschung zur Theorie der
Schweigespirale promoviert. Er ist Herausgeber des Sammelbandes "Politik und
Kommunikation -- interdisziplinär betrachtet"; seine Schwerpunkte in
Forschung und Lehre sind Methodenlehre und Online-Kommunikation. Institut für Publizistik der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz. 2007 wurde er mit einer Arbeit über
empirische Methoden und Analysestrategien für die Forschung zur Theorie der
Schweigespirale promoviert. Er ist Herausgeber des Sammelbandes "Politik und
Kommunikation -- interdisziplinär betrachtet"; seine Schwerpunkte in
Forschung und Lehre sind Methodenlehre und Online-Kommunikation.

Verwandte Artikel
Aus alt mach neu?
Über Innovationen und
Recycling im Social Web
von Astrid Lamm |