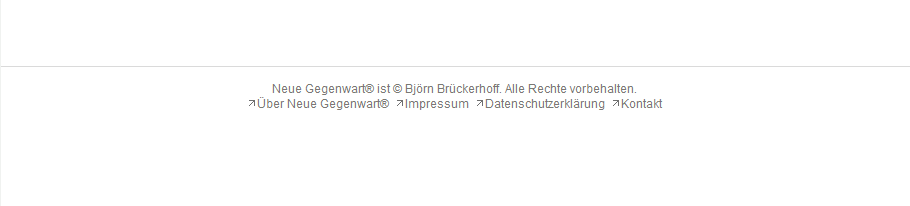|

Raus aus der Selbstbeobachtungsfalle
Text:
Tobias Eberwein
Bild: Erdbeertorte/photocase.com

Seite 4/4
 Zurück
|
Weiter
Zurück
|
Weiter

4.
Trotz aller Fortschritte hat die deutschsprachige Blogosphäre ihr
medienkritisches Potenzial noch nicht vollständig zur Entfaltung gebracht.
Das zeigt vor allem der Vergleich mit den USA, wo es mittlerweile eine webbasierte „Medienkritik in Überfülle“ (Fengler 2008: 157) gibt. Wie
Fenglers Beobachtungen belegen, unterscheiden sich die US-amerikanischen
Medienblogs in vielerlei Hinsicht von ihren Pendants in Deutschland:
 Sie können teilweise deutlich höhere Nutzerzahlen verzeichnen. Sie können teilweise deutlich höhere Nutzerzahlen verzeichnen.
 Sie werden auffallend häufig nicht von professionellen Journalisten
betrieben, sondern von Privatpersonen. Sie werden auffallend häufig nicht von professionellen Journalisten
betrieben, sondern von Privatpersonen.
 Sie begnügen sich nicht – wie etwa das „Bildblog“ – mit
Organisationskritik, sondern nehmen oft auch einzelne Journalisten gezielt
in den Blick. Sie begnügen sich nicht – wie etwa das „Bildblog“ – mit
Organisationskritik, sondern nehmen oft auch einzelne Journalisten gezielt
in den Blick.
 Sie verfolgen in vielen Fällen ein konkretes (medien-)politisches
Anliegen und sind damit eher anwaltschaftlicher Natur. Sie verfolgen in vielen Fällen ein konkretes (medien-)politisches
Anliegen und sind damit eher anwaltschaftlicher Natur.
 Sie pflegen teilweise Ansätze für eine Selbstregulierung – etwa
über die Institution „Mediabloggers“, die sich die Durchsetzung der Rechte
und Pflichten medienkritischer Blogger auf die Fahnen geschrieben und
bereits einen Ethik-Kodex verabschiedet hat. Sie pflegen teilweise Ansätze für eine Selbstregulierung – etwa
über die Institution „Mediabloggers“, die sich die Durchsetzung der Rechte
und Pflichten medienkritischer Blogger auf die Fahnen geschrieben und
bereits einen Ethik-Kodex verabschiedet hat.
 Sie sind nicht selten in elaborierte Geschäftsmodelle eingebunden
und verstehen sich teilweise sogar als dezidiert kommerzielle
Unternehmungen, was ihnen mitunter eine beachtliche finanzielle Basis
beschert. Sie sind nicht selten in elaborierte Geschäftsmodelle eingebunden
und verstehen sich teilweise sogar als dezidiert kommerzielle
Unternehmungen, was ihnen mitunter eine beachtliche finanzielle Basis
beschert.
Die skizzierten Unterschiede zeigen zugleich einige Entwicklungsoptionen für
die deutschsprachige Blogosphäre auf, wobei nicht alle der genannten Punkte
zwingend auch als wünschenswerter Zielzustand misszuverstehen sind. So haben
beispielsweise einige der personenbezogenen Watchblogs in den USA in der
Vergangenheit regelrechte Hexenjagden auf einzelne Journalisten gestartet,
die den Rahmen des ethisch Vertretbaren in vielen Fällen verließen.
Nichtsdestotrotz macht Fenglers Analyse deutlich, dass die deutschsprachigen
Medienblogs mit ihren Möglichkeiten noch längst nicht am Ende sind. Auf die
weitere Ausdifferenzierung der bestehenden Publikations-Angebote darf man
gespannt sein.
Fazit
In der Zusammenschau liefern die diskutierten Studien einige wichtige
Parameter zur Beschreibung der medienkritischen Blogosphäre und deren
Potenzial als Instrument der journalistischen Qualitätssicherung.
Gleichzeitig machen sie jedoch deutlich, dass die Erforschung der
Medienblogs gerade erst begonnen hat. Um verlässlichere und detailliertere
Erkenntnisse zu gewinnen, sind umfangreichere empirische Erhebungen mit
größerer Fallzahl und komplexeren Designs notwendig. Nur auf diese Weise
lassen sich auch differenziertere Forschungsfragen beantworten.
So wäre es beispielsweise wünschenswert, mit Hilfe von komparativen
Herangehensweisen zu prüfen, inwiefern sich die Berichterstattung der
medienkritischen Blogger inhaltlich und thematisch von der der herkömmlichen
Medienjournalisten unterscheidet. Vergleichende Inhaltsanalysen könnten
zudem Aufschluss über weitere länderspezifische Unterschiede der
Medienkritik liefern – und das nicht nur für Deutschland und die USA.
Überdies scheinen auch differenziertere Studien zur Rezeptionssituation
angebracht. Redaktionsbeobachtungen oder experimentelle Designs könnten
zeigen, welche Bedeutung weblogbasierte Medienkritik tatsächlich für den
redaktionellen Alltag hat.
Last but not least ist auch eine verbesserte theoretische Verortung der
wissenschaftlichen Befunde zu den Wechselwirkungen zwischen Journalismus und
Blogosphäre anzustreben. Dadurch ließe sich der gegebene Erkenntnisstand
weiter erhellen und für die sonstige Journalismusforschung anschlussfähig
machen. |

|

Ausgabe
56
Die Weltmaschine

Startseite
Editorial: Das Wunder von
Genf
„Alles
ist eine Frage der Konsumgewohnheiten“.
Interview mit Karlheinz Brandenburg
Was von der Zukunft
geblieben ist
Wie soziale Kontakte im StudiVZ
geknüpft und gepflegt werden
Aus alt mach neu? Über
Innovationen
und Recycling im Social Web
Raus aus der
Selbstbeobachtungsfalle!
Leben nach dem
Digitaltod
Die Entwicklung des
Internetrechts
Die Vordenker. Gesammelte
Vorträge von Denkern und Machern, die das Web prägen
Autoren dieser Ausgabe

Impressum
Themen des Magazins
Ausgabenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Verzeichnis aller
Autoren

Newsletter und RSS-Feed
Link in del.icio.us ablegen
Artikel drucken
Presse |
|
Literatur
Beuthner, Michael; Weichert, Stephan Alexander (2005): Zur Einführung:
Internal Affairs – oder: die Kunst und die Fallen medialer
Selbstbeobachtung. In: dies. (Hrsg.): Die Selbstbeobachtungsfalle. Grenzen
und Grenzgänge des Medienjournalismus. Wiesbaden, S. 13-41.
Bucher, Hans-Jürgen; Büffel, Steffen (2005): Vom Gatekeeper-Journalismus zum
Netzwerk-Journalismus. Weblogs als Beispiel journalistischen Wandels unter
den Bedingungen globaler Medienkommunikation. In: Behmer, Markus; Blöbaum,
Bernd; Scholl, Armin; Stöber, Rudolf (Hrsg.): Journalismus und Wandel:
Analysedimensionen, Konzepte, Fallstudien. Wiesbaden, S. 85-121.
Fengler, Susanne (2008): Media WWWatchdogs? Die Rolle von Blogs für die
Medienkritik in den USA. In: Quandt, Thorsten; Schweiger, Wolfgang (Hrsg.):
Journalismus online – Partizipation oder Profession? Wiesbaden, S. 157-171.
Großhans, Ellen (2005): Pseudojournalismus. Interview mit Marcel Machill.
In: Leipziger Volkszeitung vom 22. September 2005.
Hermes, Sandra (2006): Qualitätsmanagement in Nachrichtenredaktionen. Köln.
Hewitt, Hugh (2005): Blog. Understanding the information reformation that’s
changing your world. Nashville (TN).
Mayer, Florian L.; Mehling, Gabriele; Raabe, Johannes; Schmidt, Jan; Wied,
Kristina (2008): Leserschaft, Nutzung und Bewertung von Bildblog. Befunde
der ersten Online-Befragung 2007.
Möller, Erik (2006): Die heimliche Medienrevolution. Wie Weblogs, Wikis und
freie Software die Welt verändern. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage.
Hannover.
Neuberger, Christoph; Nuernbergk, Christian; Rischke, Melanie (2007): Weblogs
und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? Eine
Forschungssynopse zum Wandel der Öffentlichkeit im Internet. In: Media
Perspektiven 2/2007, S. 96-112.
 PDF-Datei PDF-Datei
Weiland, Kristin-Leonie (2006): Nabelschau.de? Aufklärung.com! In: Pörksen,
Bernhard (Hrsg.): Webwatching. Trends der Netzkultur.
 Website Website
Wied, Kristina; Schmidt, Jan (2008): Weblogs und Qualitätssicherung. Zu
Potenzialen weblogbasierter Kritik im Journalismus. In: Quandt,
Thorsten/Schweiger, Wolfgang (Hrsg.): Journalismus online – Partizipation
oder Profession? Wiesbaden, S. 173-192. |